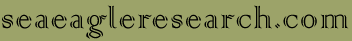

Einleitung
Der Seeadler (Haliaeetus albicilla) eignet sich aufgrund seiner Lebensweise als Spitzenprädator und seiner Langlebigkeit hervorragend als Bioindikator für Schadstoffe, daher sind Untersuchungen des Gesundheitszustandes und der Todesursachen des Seeadlers von grundlegender Bedeutung, da der Seeadler früher als der Mensch auf Schadstoffe in der Umwelt reagiert und als Konsument von Aas auch für akute Vergiftungen exponiert ist. Seine Verlustursachen sind ein Spiegel für den Umgang des Menschen mit der Natur und sein Vorkommen ist ein Hinweis auf eine ausgeprägte Artenvielfalt, da vom Schutz des Seeadlers eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen profitiert, die seinen Lebensraum teilen.
Seine Lebensraumansprüche kennzeichnen den Seeadler als Vogel der Seen, Flüsse und Meeresküste. Hier benötigt er störungsarme Horstplätze und Sitzwarten, von denen er das Gewässer und seine potentiellen Beutetiere beobachten kann. Seine Störungsempfindlichkeit ist heute noch ein Selektionsergebnis jahrzehntelanger Verfolgung durch den Menschen, die bis ins 19. Jahrhundert zurückgeht, weshalb er insbesondere während des Horstbaus und der Brutzeit sehr empfindlich auf ungewohnte Störungen reagiert. Intensive Schutzmaßnahmen und das Verbot persistenter Pestizide (z. B. DDT, Quecksilber als Saatbeize) führten seit den 1980er Jahren zu einem positiven Bestandswachstum in Deutschland und Europa.
Material und Methoden
Seit 1996 werden am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin Seeadler auf ihren Gesundheitszustand und ihre Todesursachen untersucht. Dabei werden neben routinemäßig durchgeführten Untersuchungen auch beispielsweise Mauserzustand, Körpermaße und Reproduktionsstatus berücksichtigt. Darüber hinaus werden toxikologische Analysen zur Belastung mit Schwermetallen, Pestiziden und polychlorierten Biphenylen (PCBs) durchgeführt. Röntgenaufnahmen zum möglichen Nachweis von Fremdkörpern (Beschuss) oder einer Aufnahme von Metallpartikeln (Geschosspartikel, Schrote) wurden vor der Sektion durchgeführt. Die Tierkörper stammen aus den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Sachsen, Niedersachsen, Berlin, Sachsen-Anhalt und Thüringen und wurden von Jägern, Förstern, Ornithologen, Naturschutzstationen, veterinärmedizinischen Einrichtungen und Privatpersonen zur Untersuchung an das IZW eingeschickt. Die pathologische Untersuchung der Vögel erfolgte unter besonderer Berücksichtigung von Verletzungen, Organveränderungen, Krankheiten und Parasiten. Histologische Untersuchungen zur Absicherung der Todesursachen wurden nur bei solchen Tieren durchgeführt, deren Erhaltungszustand dies zuließ. Die Einteilung der Todesursachen in die einzelnen Kategorien erfolgte aufgrund der pathologischen Befunde und der Hintergrundinformationen des jeweiligen Finders.